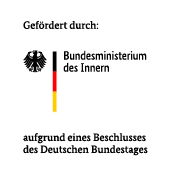Herbert Ludat – 115. Geburtstag

Insterburg
April 2025
Historiker
* 17. April 1910 in Insterburg
† 27. April 1993 in Gießen
Herbert Ludat wurde am 17. April 1910 als Sohn des Postinspektors Franz Ludat und der Ehefrau Gertrud in Insterburg (russ.: Tschernjachowsk) geboren. Seine ersten Kinderjahre verbrachte er in der ostpreußischen Heimat, jedoch zogen die Eltern schon 1913 nach Berlin. Dort besuchte Ludat das Königstädtische Realgymnasium und legte 1928 sein Abitur ab. Nach dem Abitur studierte er bis 1935 an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität die Fächer Geschichte, Germanistik, Philosophie und Slawistik mit Schwerpunkt Polnisch.
Dabei wurde er durch Gelehrte wie den Historiker Willy Hoppe, den Slawisten Max Vasmer, den Historiker Walther Vogel sowie den älteren Studienkollegen und Slawisten Heinrich Felix Schmid stark beeinflusst. Schmid und Vasmer vermittelten ihm Kontakte zu Krakauern Wissenschaftlern, während Hoppe nationalistisch gesinnt war. Ludats frühe Forschungsinteressen galten der Mark Brandenburg, besonders im Zusammenhang mit der Namensforschung.
1935 erfolgte die Promotion zum Dr. phil. über „die ostdeutschen Kietze“ (1936 bei Bernburg gedruckt). Kietze waren mittelalterliche Dienstsiedlungen, meist in unmittelbarer Nachbarschaft oder in der Peripherie ostdeutscher Städte, und hatten in der Anfangszeit ausschließlich slawische Einwohner.
Im Rahmen eines Stipendiums der Nord- und Ostdeutschen Forschungsgemeinschaft reiste Ludat von 1935 – 1937 zu Forschungszwecken nach Polen (Krakau und Lemberg), um dort den Grad der deutschen mittelalterlichen Besiedlung zu untersuchen. Dies war vor dem Hintergrund der Entspannung zwischen beiden Staaten infolge des deutsch-polnischen Nichtangriffspaktes von 1934-1938 möglich.
In Polen knüpfte er Kontakte zu Gelehrten und fand eine Faszination für polnische Geschichte.
Vermutlich um seine wissenschaftliche Karriere voranzutreiben, hielt Ludat 1936 Vorträge für die NSDAP und wurde 1937 Mitglied der Partei, nachdem im gleichen Jahr der Aufnahmestopp für neue Mitglieder gelockert worden war.
Ab 1937 leitete er das Ostmitteleuropa-Seminar der Berliner Hochschule für Politik, wo er tagespolitischen Zwängen ausgesetzt war.
Am Institut für Heimatforschung der Berliner Universität in Schneidemühl (poln. Piła), wo Ludat für die Abteilung Geschichte & Sprachen leitend tätig war, hoffte er dagegen auf eine stille und objektive Auseinandersetzung mit der Mittelalterforschung.
Dieser Balanceakt zwischen politischen Zugeständnissen und wissenschaftlicher Korrektheit klappte nur bedingt.
So ergab sich (ab etwa 1938) bei den veröffentlichten Artikeln/Texten („Wiedereindeutschung Ostelbiens“ „polnischer Expansionismus“), der Habilitationsschrift (1940) sowie einer Antrittsvorlesung ein widersprüchliches und uneinheitliches Bild, bei dem einerseits ein gewisser „akademischer Antisemitismus“ sowie ein antipolnischer Nationalismus durschienen, aber andererseits eine Verherrlichung der polnischen Geschichtswissenschaft sowie des polnischen mittelalterlichen Entwicklungsprozesses demgegenüber standen.
Ende 1940 habilitierte sich Ludat in Berlin über das „Bistum Lebus. Studien zur Gründungsfrage und zur Entstehung und Wirtschaftsgeschichte seiner schlesisch-polnischen Besitzungen“. (Weimar 1942)
1941 erhielt er die „Venia Legendi“ (Lehrbefähigung) an der Universität Berlin für das Fach Geschichte und wurde ebenfalls im gleichen Jahr an die im annektieren Reichsgau Wartheland neugegründede Reichsuniversität Posen als Dozent für mittlere und neuere Geschichte berufen, wo er aufgrund einer gleichzeitigen Einberufung zur Wehrmacht nicht tätig werden konnte.
1945 kam Ludat in die britische Besatzungszone, habilitierte sich an der Kieler Universität um und dozierte dort bis etwa 1947, d. h. bis zur Übersiedlung nach Münster: Zunächst als Diätendozent, ab 1951 als außerplanmäßiger Professor.
1948 erfolgte eine Zwischenstation als „British Council Fellow“ an der Universität Liverpool.
1955 kam die Ernennung zum wissenschaftlichen Rat in Münster dazu.
Nach einer kurzen Zwischenstation an der Universität Mainz, leitete er 1956 an der Justus-Liebing-Universität Gießen den Lehrstuhl für Agrar,- Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte des europäischen Ostens sowie wenig später das Institut für kontinentale Agrar- und Wirtschaftsforschung, wo vielfältige organisatorische und koordinierende Aufgaben zu bewältigen waren.
Ebenfalls 1956 wurde Ludat Mitglied der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung.
Ab 1957 – 1965 hatte Ludat eine Honorarprofessur am Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte an der Uni Marburg inne, wo er auch bereits seit 1954 Mitglied des dortigen Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrats geworden war.
Ab 1972 beschränkte sich die Leitung am Institut für kontinentale Agrar- und Wirtschaftsforschung auf die Abteilung für die Geschichte Osteuropas.
1978 folgte die Versetzung in den Ruhestand.
Wichtige Schüler waren die Historiker Klaus-Detlev Grothusen, Klaus Zernack, Hans-Dietrich Kahl sowie Christian Lübke.
Erwähnenswert sind auch Ludats Mitbegründerschaft der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission sowie die 1968 verliehene Palacký-Medaille der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften.
Ludat stand nach dem Krieg in engem Kontakt zu polnischen Wissenschaftlern (u. a. Gerard Labuda, Andrzej Poppe, Benedykt Zientara), die als Gastprofessoren oder Stipendiaten nach Gießen kamen und bei ihm perfekte Arbeitsbedingungen sowie die Möglichkeit zum gegenseitigen Gedankenaustausch hatten.
Auch entwickelte er (neben Heinrich Felix Schmid) den die außerrussischen Slawenvölker umfassenden Europagedanken, der im Gegensatz zur traditionellen Ostforschung (deutsche kulturelle Überlegenheit) stand und wonach Polen wieder seine legitime Stellung in Europa erhielt.
Seine großen Forschungsfelder waren die Genese der deutsch-polnischen Beziehungen im Mittelalter, die Stadtgeschichte des mittelalterlichen Slawentums, das moderne Geschichtsbewusstsein in Polen sowie die polnische Historiographie. Dazu veröffentlichte er zahlreiche wissenschaftliche Beiträge.
Damit leistete Herbert Ludat einen wichtigen Beitrag zur europäischen Versöhnung.
Dies sieht man eindrucksvoll daran, dass die Festrede zum 70. Geburtstag der tschechische Historiker František Graus hielt und dass an der entsprechenden Festschrift „Europa Slavica – Europa Orientalis“ neben dreizehn deutschen Kollegen und Schülern, sieben polnische, ein ungarischer sowie ein kroatischer Kollege beteiligt waren.
Einige seiner Werke wurden auch ins Polnische übersetzt (siehe unten).
Die letzten 20 Jahre waren geprägt von schwindenden Kräften und gesundheitlichen Problemen.
Herbert Ludat starb schließlich nach mehrjähriger schwerer Krankheit 1993 in Gießen.
Werke (Auswahl):
Die ostdeutschen Kietze, Bernburg, 1936.
Polens Stellung in Ostmitteleuropa in Geschichte und Gegenwart, Berlin, 1939.
Bistum Lebus. Studien zur Gründungsfrage und zur Entstehung und Wirtschaftsgeschichte seiner schlesisch-polnischen Besitzungen, Weimar, 1942.
Vorstufen und Entstehung des Städtewesens in Osteuropa. Zur Frage der vorkolonialen Wirtschaftszentren im slavisch-baltischen Raum. Köln 1955.
Die ältesten geschichtlichen Grundlagen für das deutsch-slawische Verhältnis, In: Das östliche Deutschland. Ein Handbuch, Würzburg, 1959.
Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder, Giessen, 1960.
Liegt Polen noch in Europa? 6 Antworten, Giessen, 1961.
Polen und Deutschland. Wissenschaftliche Konferenz polnischer Historiker über die polnisch-deutschen Beziehungen in der Vergangenheit. Köln 1963.
Das Lebuser Stiftsregister von 1405: Studien zu den Sozial- und Wirtschaftsverhältnissen im mittleren Oderraum zu Beginn des 15. Jahrhunderts : T. 1., Wiesbaden, 1965.
Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit, Wiesbaden, 1967.
Deutsch-slawische Frühzeit und modernes polnisches Geschichtsbewußtsein: Ausgewählte Aufsätze, Köln, 1969.
An Elbe und Oder um das Jahr 1000: Skizzen zur Politik des Ottonenreiches und der slavischen Mächte in Mitteleuropa, Köln, 1971.
Slaven und Deutsche im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze zu Fragen ihrer politischen, sozialen und kulturellen Beziehungen, Köln, 1982.
Werke (Polnische Übersetzung):
Słowianie, Niemcy, Europa. Wybór prac., Marburg-Poznań, 2000.
Piastowie i Ekkehardynowie. In: Przegląd Historyczny 91/2, 181-201, 2000.
Piastowie i Ottonowie. Wokół zjazdu gnieźnieńskiego. In: Zapiski Historyczne, 65/2, 7-30, 2000.
Quellen:
Ostdeutsche Gedenktage 1990, Bonn, 1989, s. 67 ff.
Nachrichten der Giessener Hochschulgesellschaft, Band 26, Giessen, 1957.
Handbuch der völkischen Wissenschaften – Akteure, Netzwerke, Forschungsprogramme, Teil 1, Oldenbourg, 2017.
Herbert Ludat (1910 – 1993), „Mediewiśći“, Band 4, S. 161 – 172, Jerzy Strzelczyk, 2016:
https://mediewisci.lhdb.kul.pl/files/original/5ebd3d8f8142a3ac704afdeb2b3b7bf4580dc6ff.pdf
Bibliographie der Mitglieder des J. G. Herder-Forschungsrats von 1985 bis 2000, Marburg, 2003.
Ostdeutsche Gedenktage 1990, Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 1989: https://kulturstiftung.org/biographien/ludat-herbert-2
https://www.lagis-hessen.de/pnd/118574833
https://schulbuchkommission.eu/mitglieder/prof-dr-herbert-ludat/
https://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Ludat%2C+Herbert
https://professorenkatalog.online.uni-marburg.de/de/pkat/details?entityId=19¤t=114&camefrom=periods |