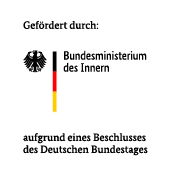Ernst Ludwig Siehr – 80. Todestag

Insterburg - Alter Markt
November 2025
Politiker
* 5. Oktober 1869 in Heinrichswalde bei Tilsit
† 14. November 1945 in Bergen (Rügen)
Ernst Ludwig Siehr wurde als Sohn des Kreisrichters und späteren Geheimen Justizrats, Carl Siehr, und der Kaufmannstochter Pauline geb. Albrecht in Heinrichswalde (heute: Slawsk) im Kreis Niederung geboren. Er hatte noch 5 Brüder und eine Schwester, die früh verstarb. Nachdem der Vater im Rahmen seiner Anwaltstätigkeit von Tilsit nach Angerburg gezogen war, besuchte Ernst Siehr dort von 1876 - 1879 die Bürgerschule.
Als der Vater am 1. Oktober 1879 erneut den Tätigkeitsort wechselte – diesmal nach Insterburg – ging der Sohn dort auf das Gymnasium, welches er 1886 mit dem Abitur abschloss. In der Zeit von 1886 – 1889 studierte Ernst Siehr an der Albertus-Universität in Königsberg, an der LMU München sowie an der FWU Berlin Rechtswissenschaften. Während des Studiums wurde er Mitglied der Landsmannschaft Littuania. 1889 wurde er Referendar (Erstes juristisches Staatsexamen) und am 1. Dezember 1894 Assessor (Zweites juristisches Staatsexamen). Den Wehrdienst leistete er 1891/92 als Einjährig-Freiwilliger beim 1. Feldartillerie-Regiment ab. Ab Januar 1895 konnte Ernst Siehr als Sozius in der Kanzlei seines Vaters in Insterburg die Anwaltstätigkeit aufnehmen.
Ebenfalls von 1895 (bis 1911) wurde er Syndikus der örtlichen Handelskammer. Am 23. April 1895 trat Siehr der Insterburger Freimaurerloge „Zum preußischen Adler“ bei. Am 26. April 1895 schloss er den Bund der Ehe mit Paula geb. Albrecht (1876 – 1956). Aus dieser Ehe entstammten vier Söhne und zwei Töchter. Ab 1906 übernahm Ernst Siehr auch das Nebenamt als Notar in der väterlichen Kanzlei, ein Jahr bevor der Vater starb. Von 1908 bis 1920 war er Stadtverordneter (zuletzt sogar Stadtverordnetenvorsteher) in Insterburg. 1911 kandidierte er als Mitglied der Fortschrittlichen Volkspartei für den Reichstag. Er setzte sich 1912 in einer Stichwahl gegen den konservativen Dr. Ernst Brandes-Althof durch und zog so in den Reichstag ein, dessen Mitglied er bis 1918 war.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs meldete sich Ernst Siehr am 20. August 1914 als Vizefeldwebel beim mobilen Landsturmbataillon in Insterburg, wo er nach wenigen Monaten zum Adjutanten des Bataillons und schließlich zum Leutnant der Landwehr aufstieg. Dort wurde er an der Front eingesetzt, aber zu wichtigen Reichstagssitzungen beurlaubt, so auch Anfang November 1918, als die Revolution in Berlin tobte und der Sozialdemokrat Philipp Heinrich Scheidemann am 9. November die Republik ausrief. Kurz darauf kehrte Siehrvon Berlin nach Insterburg zurück und sorgte zusammen mit dem Oberbürgermeister Dr. Otto Rosencrantz für einen friedlichen Übergang. Anfang 1919 wurde Siehr für die Deutsche Demokratische Partei in die Nationalversammlung gewählt, die kurz darauf in Weimar zusammenkam. Im Rahmen des kurzlebigen sog. „Ostparlaments“, das aus Parteien und Abgeordneten aus den Ostprovinzen bestand, war Siehr im Aktionsausschuss „Nord“ tätig.
Nach dem missglückten Kapp-Putsch vom 13. – 17. März 1920 und der Ablösung des Oberpräsidenten August Winning, der die neuen kurzlebigen Machthaber anerkannt hatte, wurde Ernst Ludwig Siehr zuerst kommissarisch, Ende Juli offiziell zum Oberpräsidenten der Provinz Ostpreußen ernannt.
In dieser Position galt es, mehrere Aufgaben zu bewältigen wie die Untersuchungen im Zusammenhang mit dem versuchten Staatsstreich, Fragen in Bezug auf den „Korridor“, der Ostpreußen vom übrigen Reichsgebiet abschnitt, die Einrichtung einer „Ostpreußenstelle“ in Berlin als Vertretung des Oberpräsidenten beim Reichs- und Staatsministerium, die Volksabstimmung vom 11. Juli 1920 oder etwa die Grenzsicherung Ostpreußens angesichts des Polnisch-Sowjetischen Krieges, der 1920 in der Nähe tobte.
Auch um das Wohl der Elche sorgte sich Ernst Siehr. So erklärte er 1920 die Elche zum „Naturdenkmal“ und verfügte eine dreijährige Schonzeit, die zu einer erheblichen Erholung des Bestands auf über 1000 Tiere bis 1930 führte, wofür ihm der Allgemeine Deutsche Jagdschutzverein die goldene Medaille und den Ehrenschild verlieh.
1929 erhielt Ernst Siehr gleich mehrere Ehrungen: Ehrendoktorwürde der Juristischen Fakultät der Albertus-Universität zu Königsberg, Ehrenbürgerschaft der Stadt Insterburg, Widmungsgedicht der Dichterin Johanna Ambrosius.
Von 1923 – 1926 gehörte er zum Gründungsvorstand der historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung und ab 1930 war er Mitglied der Altertumsgesellschaft von Insterburg.
Während seiner Amtszeit wurden viele wichtige Infrastrukturprojekte durchgeführt, wie die Vertiefung des Königsberger Seekanals (1925 – 1930), die Einrichtung des Seedienstes Ostpreußen (ab 1920) oder der Ausbau des Königsberger Hafens zum Hochseehafen (ab 1921).
Nachdem es zu Anfang des Jahres 1932 zu Konflikten in der Regierung gekommen war, reichte Ernst Siehr seinen Rücktritt zum 30. September 1932 ein und nahm seine ursprüngliche Anwalts- und Notartätigkeit wieder auf. Königsberg konnte er gerade noch rechtzeitig verlassen, bevor die Rote Armee die Stadt einschloss. So fand er sich als Flüchtling in Bergen auf Rügen wieder, wo er kurze Zeit später starb.
Das Familiengrab befindet sich heute auf dem Frankfurter Südfriedhof.
Quellen:
Ostdeutsche Gedenktage 1995, Bonn, S. 224 ff.
Das Ostpreußenblatt, Jahrgang 45, Folge 11, 15. Oktober 1994, Seite 12.
Das Ostpreußenblatt, Nr. 27, 9. Juli 2021, Seite17.
https://kulturstiftung.org/biographien/siehr-ernst-ludwig-2
https://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0u1/adr/adrsz/kap1_1/para2_335.html
https://ostpreussen.net/2021/03/21/die-kurische-nehrung/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Siehr |